| Volksdichter |
 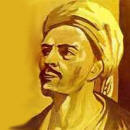  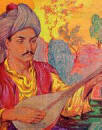 |
|
|
Volksdichter
Aşık Veysel Şatıroğlu
Volksdichter
Aşık Veysel (1894 – 1973)
Leben
"Im Jahre Dreizehnhundertzehn (1310) kam ich auf diese Welt"
Veysel Şatıroğlu kam im Jahre 1894 im Dorf Sivrialan des Sivas Landkreises
Şarkışla zur Welt. Die Geschichte, wie Veysel das Licht der Welt erblickte,
ist eigentlich die Geschichte vieler Kinder, die in anatolischen Dörfern zur
Welt kommen. Allerdings ist seine Art der Geburt für jene, die heute auf ein
solches Ereignis blicken, und vor allem für Außenstehende sehr interessant,
ja sogar außergewöhnlich.
Als seine Mutter Gülizar Ana auf die Ayıpınar- Weide in der Umgebung von
Sivrialan ging, um Schafe zu melken, überkamen sie die Geburtswehen. Auf
dieser Weide wurde Veysel auf die Welt gebracht. Die Nabelschnur wurde von
ihr selbst durchgetrennt, sie wickelte ihr Neugeborenes in ein Tuch und
kehrte zu Fuß wieder in ihr Dorf zurück.
Die Familie von Veysel wurde von der Dorfbevölkerung "Şatıroğulları" (Die
von den Şatırs abstammen) genannt. Sein Vater Ahmet, mit dem Spitznamen
"Karaca" (dunkel) war Bauer. Als Veysel zur Welt kam, wurde das Volk von
Sivas von den Pocken gequält. Zwei Mädchen, die vor Veysel geboren wurden,
mussten durch diese Krankheit ihr Leben lassen.
Als Veysel sieben Jahre wurde, also im Jahre 1901, brach in Sivas die
Pockenkrankheit erneut aus. Auch er wurde von dieser Krankheit angegriffen.
Er erzählt diese Tage folgenderweise: „Bevor ich von den Pocken befallen
wurde, hatte mir meine Mutter einen schönen "entari" (langes, loses Gewand)
genäht. Ich zog dieses Kleid an und ging zur, von mir sehr geliebten Frau
Muhsine, um es ihr zu zeigen. Sie hat mich liebkost. An diesem Tag gab es
sehr viel Schlamm. Als ich nach Hause zurückkehrte, rutschte ich aus und
fiel hin. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich hatte die Pocken erwischt....
Die Pocken waren heftig. Das linke Auge wurde stark betroffen, doch für das
rechte Auge sollte es noch schlimmer werden, ich bekam den Star. Von dem Tag
an bis heute verdunkelte sich die Welt.“
Nach diesem Fall kam in Veysels Kopf immer wieder eine Farbe zum Vorschein;
Rot. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde seine Hand bei diesem Fall wund
geschürft und blutete. Dies erzählt seine Frau Gülizar Ana folgendermaßen:
„Es ist nicht unbekannt, von den Farben erinnert er sich nur an Rot. Bevor
seine Augen erblindeten, also bevor er von den Pocken befallen wurde, ist er
gefallen. Er sah Blut. Er konnte sich nur an die Farbe des Blutes erinnern.
Rot.... Grün hat er mit den Händen erfahren und liebkost.“
Für das rechte Auge gab es eine Chance zu sehen. Zu dem Zeitpunkt konnte er
noch Licht unterscheiden. In der Nähe des Dorfes, in Akdağmadeni, gab es
einen Doktor. Man sagte seinem Vater „Bring dein Kind nach Akdağmadeni, dort
gibt es einen Doktor, der ihm wieder die Augen öffnen kann.“ Sein Vater
freute sich.
Allerdings wurde Veysel vom Unglück nicht losgelassen. „Als er eines Tages
die Kühe molk, trat sein Vater zu ihm. Als sich Veysel plötzlich umdrehte,
fuhr die Spitze eines Stockes, den sein Vater in der Hand hielt, in sein
anderes Auge. Somit ging auch dieses Auge verloren.“
Veysel hatte einen älteren Bruder namens Ali und eine Schwester namens Elif.
Die gesamte Familie hatte diesen Umstand sehr bedauert und weinte tagelang.
Veysel begann dann an der Hand seiner Schwester spazieren zu gehen. Aber
Veysel verschloss sich zunehmend. In dem Gebiet Emleg, in der Umgebung von
Sivas, gab es viele Âşık- Dichter / Volkslieddichter. Auch Veysels Vater
interessierte sich sehr für diese Gedichte und war der Tekke- Dichtung sehr
zugetan. Er gab Veysel ein Saz, mit dem Gedanken, dass diese Beschäftigung
seinen Schmerz etwas lindern würde. Er versuchte seinen Sohn zu trösten,
indem er die Gedichte der Volkslieddichter vorlas und sie ihn auswendig
lernen lies. Auβerdem kamen von Zeit zu Zeit die örtlichen Volkslieddichter
in das Haus seines Vaters Ahmet Şatıroğlu und trugen ihre Gedichte vor.
Veysel horchte mit großer Neugierde zu. Der Nachbar Molla Hüseyin pflegte
die Saz und ersetzte gerissene Saiten durch neue.
Seinen ersten Unterricht bekam er von einem Freund seines Vaters, den aus
dem Dorf Divriği stammenden Çamışıhlı Ali Ağa (Âşık Ala). Er selbst übte
sich geduldig auf der Saz. Er begann die Gedichte von Meisterdichtern
nachzusingen. Vor allem Çamışıhlı Ali macht Veysel mit der Welt der
Volkslieddichter bekannt, die seine dunkle Welt erleuchteten. So lernt
Veysel die Welt der Volkslieddichter wie Pir Sultan Abdal, Karaoğlan, Dertli
und Rühsati kennen.
"In Âşık Veysels Leben kam es zur zweiten bedeutenden Veränderung. Sein
Bruder Ali ging in den Krieg, der kleine Veysel blieb mit seiner, mit
gerissenen Saiten versehenen Saz, allein. Nach dem Ausbruch des Krieges
schlossen sich alle Freunde und Altersgenossen Veysels dem Krieg an. Auch
dies war Veysel versagt...
So öffnete sich für seine zurückgezogene Seele eine weitere Einsamkeit. Der
Schmerz, ohne Freunde zu sein, sein Elend machte ihn sehr hoffnungslos,
pessimistisch und traurig. Er verbrachte sein Dasein damit, unter dem
Birnenbaum des kleinen Gartens zu liegen, in den Nächten auf den Baum zu
klettern und dort seine Trauer mit dem Himmel und der Finsternis zu teilen.“
Diese Tage erzählt Aşık Veysel Enver Gökçe folgendermaßen:
"Ich betrete das Haus, mein Gesichtsausdruck ist mürrisch: Meine Mutter und
mein Vater wissen über meinen Zustand nicht bescheid. Ich kann ihnen meine
Trauer nicht erklären, in der Angst, sie zu verletzen. Sie glauben, dass ich
aufsässig sei, ich drückte mich nur davor, meine Probleme zu erzählen, und
zwar so, dass ich sogar der Saz überdrüssig wurde.“
Wenn darin auch etwas der Einfluss des Männlichkeitsbildes in Anatolien zu
spüren ist, so ist es doch mehr Veysels Vaterlandsliebe, sein Gefühl, seine
Schuld dem Vaterland zurückzuzahlen, das hier zum Ausdruck kommt. Später
drückt er es in seinen Versen wie folgt aus:
"Wie schade, das Schicksal war nicht auf meiner Seite
Als das Volk den Feind in das Meer zurückwarf
Das Schicksal brach mir den Arm, gab mir keinen Dienst
Um dem Feind mit dem Schwert auf den Kopf zu schlagen.
Wenn es mir in diesen Tagen vergönnt gewesen wäre
Ich hätte nicht um einen Löffel Blut ersucht
Das vorherbestimmte Schicksal käme nicht zum Vorschein
Was ist diesem Veysel nicht alles zugestoßen."
Veysels Mutter und Vater verheiraten Veysel gegen Ende der Mobilisierung mit
dem Gedanken „Vielleicht sterben wir und sein Bruder kann nicht auf Veysel
schauen“ mit einem verwandten Mädchen namens Esma. Esma schenkt Veysel eine
Tochter und einen Sohn. Sein Sohn stirbt bereits mit 10 Tagen, die
Brustwarze der Mutter im Mund.... Die Schicksalsschläge Veysels enden nicht.
Widrigkeiten und Pech folgen aufeinander. Am 24. Februar des Jahres 1921
stirbt seine Mutter, sein Vater 18 Monate später. Zu dieser Zeit beschäftigt
er sich mit Gemüsegärten. In das Dorf kommen viele Âşık- Dichter, angefangen
von Karacaoğlan, Emrah, bis zu Âşık Sıtkı, Âşık Veli, sie spielen mit ihrer
Saz und tragen ihre Verse vor. Veysel bleibt dieser Musik in den Dorfzimmern
nicht fern.
Als sein großer Bruder noch eine Tochter bekommt, nehmen sie einen Diener in
ihren Dienst auf, um auf die Kinder aufzupassen und einigen Arbeiten
nachzugehen. Dieser Diener ist später für einen weiteren Schicksalsschlag
Veysels verantwortlich. Als Veysel eines Tages krank niederlegt und sein
Bruder Ali Melisse sammelte, entführt dieser Diener Esma, Veysels erste Frau.
Somit wurde Veysel in seinem geprüften Leben ein weiterer Schmerz zugefügt.
Als seine Frau ihn mit dieser Flucht verließ, hinterließ sie ein gerade
sechste Monate altes Mädchen. Zwei Jahre trug er dieses Mädchen auf seinem
Schoß, denn es blieb ihm nichts anderes übrig.
So schrieb er auch in einem seiner Gedichte:
"Das Schicksal ist gleichzusetzen dem Leid
Wo immer ich auch hingehe, es folgt mir hinterher."
Kurz gesagt, eine Kette tausender Schmerzen.
Er befindet sich nach all diesem in einem psychischen Zustand, in dem er nur
mehr wünscht, zu fliehen, sich von dieser Welt zu entfernen. Im Jahre 1928
beschließt er gemeinsam mit seinem besten Freund Ibrahim nach Adana zu gehen.
Allerdings kann Deli Süleyman, ein im Sivaser Dorf Karaçayır lebender
Âşık- Dichter, ihn von dieser Reise zurückhalten. Horchen wir Veysel zu:
"Dieser Mann horcht mir zu, wenn ich die Saz spiele, er unterbricht mich,
wenn ich spreche. Ich gehe, sage ich, doch mit seinen Worten ‚Ah Freund, die
Kinder werden bitterlich weinen, komm, geh doch nicht’, bindet er mir Hände
und Füße. Endlich halte ich es nicht mehr aus, ich gehe nicht und damit
basta. Und so gab ich diese Reise auf."
Veysels erstes Verlassen seines Dorfes: Ein Mann namens Kasım aus dem Dorf
Barzan Baleni bei Zara bringt Veysel in sein Dorf und beide leben dort drei
Monate gemeinsam unter einem Dach. Deli Süleyman, der ihn nicht nach Adana
gehen ließ, und der Sivaser Kalaycı Hüseyin begleiten ihn. Auf dem Rückweg
besucht Veysel die Dörfer Yalıncak bei Hafik und Girit bei Zara und ersteht
für 9 Lira eine schöne Saz. Auf dem Weg von Sivas nach Sivrialan werden die
Freunde von Bauernfängern betrogen und verlieren ihr gesamtes Geld. Auch die
9 Lira von Veysel werden eingesetzt und im Spiel verloren. Einige Zeit nach
diesem Vorkommnis heiratet Veysel eine Frau namens Gülizar aus dem Dorf
Karayaprak bei Hafik.
Im Jahre 1931 gründet Ahmet Kutsi Tecer, Literaturlehrer des Sivas
Gymnasiums, gemeinsam mit seinen Freunden den "Verein zum Schutz der
Volkslieddichter" Und am 5. Dezember 1931 veranstalten sie ein drei Tage
währendes Fest der Volksdichter. Damit begann auch ein wichtiger Wendepunkt
in Veysels Leben. Man kann durchaus sagen, dass die Bekanntschaft Veysels
mit A. Kutsi Tecer seinem Leben einen neuen Anfang gegeben hat.
Bis zum Jahre 1933 singt er die Lieder und Verse von Meistern der
Volkslieddichtung nach. Zum 10. Jahrestag der Republik verfassten alle
Volkslieddichter unter der Anweisung von A. Kutsi Tecer über die Republik
und Gazi Musfafa Kemal Verse. Darunter befand sich auch Veysel. Das erste
eigenständige Gedicht Veysels beginnt mit der Zeile „Es war Atatürk, der die
Türkei wieder auferstehen ließ...“. (Atatürk’tür Türkiye’nin ihyası...).
Dieses Erscheinen des Gedichtes bedeutete auch gleichzeitig Veysels
Verlassen seiner dörflichen Grenzen.
Dieses Heldenlied Veysels fand großes Gefallen bei Ali Rıza Bey, dem
Kreisvorsteher von Ağacakışla, in dessen Zuständigkeit auch Sivrialan
gehörte. „Lass es uns nach Ankara schicken“, wünscht sich Ali Rıza Bey. „Ich
gehe selbst zum ‚Ata’ (Vater; Atatürk)“ antwortet Veysel und macht sich
gemeinsam mit seinem loyalen Freund Ibrahim zu Fuß auf den Weg. Diese zwei
reinen Seelen, im tiefsten Winter barfuss und ohne Kopfbedeckung, erreichten
nach mühevollen drei Monaten Ankara. In Ankara wurde Veysel von
gastfreundlichen Bekannten als Gast aufgenommen und blieb in deren Haus 45
Tage. Auch wenn er leidenschaftlich davon spricht, dieses Heldenlied Atatürk
vorzutragen, so ermöglichte es ihm sein Schicksal nicht. Seine Frau Gülizar
Ana: „Erstens, er konnte nicht zum Vater (Atatürk) gehen; zweitens, er nahm
nicht am Krieg teil; er klagte, war dies alles nur möglich...“. Allerdings
wird das Heldenlied der Druckerei der Zeitung Hakimiyet-i Milliye übergeben
und drei Tage hindurch erscheint es in der Zeitung. Danach wurde dieses
Heldenlied Veysels im ganzen Land herumgereicht, wo es bekannt wurde,
vorgesungen, geliebt und geehrt.
Diese Tage berichtet er folgendermaßen: „Wir haben das Dorf verlassen. Zu
Fuß passierten wir die Dörfer von Yozgat und Çorum- Çankırı, innerhalb von
drei Monaten erreichten wir Ankara. Wir hatten kein Geld, um uns ein Hotel
zu nehmen. ‚Wohin gehen wir, was sollen wir machen?’ Dann wurde uns gesagt:
‚Hier gibt es einen Paşa Dayı (Anrede für einen alten Pascha) aus Erzurum.
Dieser Mann ist sehr gastfreundlich.’ Dieser Paşa Dayı hatte ein Haus in dem
damaligen Stadtteil Dağardı (heute: Atıf Bey Mahallesi). Wir gingen zu ihm
und tatsächlich hat dieser gute Mann uns als Gäste willkommen geheißen. Wir
blieben einige Tage. Damals gab es in Ankara noch keine Fahrzeuge, alles
wurde mit dem Pferdewagen ausgeführt. Wir lernten einen Mann namens Hasan
Efendi kennen, der einen solchen Pferdewagen besaß. Dieser hat uns zu sich
nach Hause gebracht. 45 Tage blieben wir in Hasan Efendis Haus. Wir kommen
und gehen, dieser Mann hat uns alles, vom Essen bis zum Bett, zur Verfügung
gestellt. Ich sagte: ‚Hasan Efendi, wir sind nicht hierher gekommen, um
spazieren zu fahren. Wir haben ein Heldenlied geschrieben. Dieses möchten
wir Gazi Mustafa Kemal zu Gehör bringen. Wie sollen wir dies machen?’ Er
antwortete: ‚Also wirklich, ich bin nicht der richtige Mann für solche
Arbeiten. Aber es gibt hier einen Abgeordneten namens Mustafa Bey, seinen
Nachnamen habe ich vergessen. Wir müssen dies diesem Mann mitteilen.
Vielleicht kann er euch helfen.’
Und so gingen wir zu Mustafa Bey und erzählten ihm von unserem Anliegen. Wir
haben ein Heldenepos geschrieben und möchten es Gazi Mustafa Kemal zu Gehör
bringen. ‚Hilf uns!’ forderten wir ihn auf.
Er antwortete: ‚Ach, nicht doch! In dieser Zeit gibt es niemanden, der
Gedichten und solchen Sachen Wert beimisst. Singt es an irgendeiner Ecke.
Vergesst es und geht!’
'Nein, so nicht’, sagten wir. ‚Wir werden dieses Heldenlied Mustafa Kemal
vortragen!'
Der Abgeordnete Mustafa Bey sprach daraufhin, ‚Also gut, singt mal vor, so
dass wir es hören.’ Und wir trugen es vor, er horchte zu. Er sagte, dass er
mit der in Ankara herausgegebenen Zeitung Hakimiyet-i Milliye sprechen werde
und rief uns am nächsten Tag wieder zu sich. Wir kamen, doch er sagte, 'Es
geht mich nichts an.’ Dann brach er das Gespräch ab. Wir kamen von ihm
zurück und überlegten, was wir unternehmen sollten. Letztendlich entschieden
wir uns dafür, selbst in die Druckerei der Zeitung zu gehen. Der çarşı (Markt)
auf dem Hauptplatz von Ulus (früheres Zentrum von Ankara) wurde damals
Karaoğlan Çarşı genannt. Dorthin gingen wir, um Saiten für die Saz zu kaufen.
An den Füßen trugen wir ‚çarık’ (grobe Bauernschuhe aus ungegerbtem Leder),
an den Beinen einen şal- şalvar (weite Pluderhose aus Kaschmirstoff), eine
Kaschmirjacke und um die Hüften einen großen ‚kuşak’ (Leibgurt)! Da kam die
Polizei auf uns zu: ‚Halt. Es ist verboten in den Çarşı zu gehen!’ Sie
wollten es uns nicht erlauben, im Çarşı Saiten für die Saz zu kaufen.
Die Polizei bestand weiter: ‚Verboten, sagen wir. Versteht ihr nicht, was
ein Verbot ist? Es herrscht ein großer Menschenauflauf. Geht nicht in die
Masse!’
Wir antworteten, dass wir draußen bleiben würden, allerdings gingen wir
weiter unseres Weges. Der Polizist kam wieder auf uns zu und drohte Ibrahim:
‚Seid ihr unbewaffnet? Ich sage euch, dass ihr hier bleiben sollt! Ich werde
deinen Kopf zerschlagen!’
Wir sagten, ‚Geehrter Herr, wir möchten uns nicht ausruhen. Wir möchten nur
eine Saz- Saite im Çarşı kaufen!’ Der Polizist wies daraufhin Ibrahim an,
die Saite zu kaufen, und mich irgendwo hinzusetzen. So konnte Ibrahim die
Saite kaufen, die wir sofort an der Saz befestigten. Morgens konnten wir
wieder nicht den Çarşı überqueren, doch letztendlich fanden wir die
Druckerei.
'Was wollt ihr?’ fragte der Direktor.
'Wir haben ein Heldenlied geschrieben und möchten es der Zeitung überreichen.’,
antworteten wir.
'Dann spielt mal, damit ich es höre!’, forderte er uns auf.
Wir spielten und er horchte uns aufmerksam zu.
'Ah! Sehr schön, es ist wunderschön!’ rief er aus.
Und es wurde in der Zeitung gedruckt.‚ Morgen wird es erscheinen. Kommt dann
und holt euch die Ausgabe.’, wurde uns gesagt. Sie gaben uns auch etwas Geld
als Urheberrecht. Am Morgen holten wir uns 5-6 Zeitungen. Wieder mussten wir
über den Çarşı gehen.
Die Polizei: ‚Oh! Sind Sie Âşık Veysel? Machen Sie es sich gemütlich! Gehen
Sie in ein Kaffee, setzen Sie sich!’ Es begann eine Zuwendung, fragen Sie
nicht. Im Çarşı sind wir geraume Zeit spaziert. Allerdings hörten wir von
Mustafa Kemal nichts. Wir sagten uns, ‚Daraus wird wohl nichts werden.’ Aber
die Zeitung Hakimiyet-i Milliye veröffentlichte mein Heldenlied drei Tage
hintereinander. Trotzdem hörten wir von Mustafa Kemal nichts. Wir
entschieden, ins Dorf zurückzukehren. Allerdings hatten wir nicht mal Geld
für die Rückreise. In Ankara hatten wir einen Rechtsanwalt kennen gelernt.
Dieser Rechtsanwalt sagte, ‚Ich werde an den Bürgermeister einen Brief
schreiben. Die Gemeinde wird Sie gratis in Ihr Dorf zurückbringen!’ Und er
überreichte uns einen Brief mit dem wir zum Gemeindeamt gingen. Dort sagte
man uns: ‚Sie sind Künstler. Gehen Sie doch, wie Sie gekommen sind!’
Wiederum haben wir den Rechtsanwalt aufgesucht, der uns fragte, was wir
gemacht hätten. Wir erzählten ihm unsere Geschichte. ‚Wartet, wir schreiben
auch an den Gouverneur.’, sagte er und setzte ein Ansuchen an den Gouverneur
auf. Der Gouverneur unterschrieb dieses Ansuchen und schickte uns wiederum
zur Gemeinde. Doch die Gemeinde antwortete uns: ‚Nein! Wir haben kein Geld!
Wir können Sie nicht zurückschicken!’.
Der Rechtsanwalt wurde ärgerlich und fluchte: ‚Verschwindet! Kehrt zu Eurer
Arbeit zurück! Die Gemeinde Ankara hat für Euch kein Geld. Es ist verbraucht!’
Ich habe den Rechtsanwalt bedauert.
Während wir überlegten, was wir machen sollten und wie wir es anstellen
sollten, fiel uns ein, dass wir doch auch beim ‚Halkevi’ (Volkshaus;
Einrichtung der Republikanischen Volkspartei zur Hebung der Volksbildung und
Verbreitung des Kemalismus) vorbeischauen sollten. Vielleicht würde dort
etwas für uns herausschauen. Wir konnten nicht zu Mustafa Kemal vordringen,
so wollten wir doch zum Halkevi gehen. Dieses Mal ließen uns die Türsteher
des Halkevi nicht hinein. Wir blieben dort wie angewurzelt stehen.
Ein Mann kam heraus und fragte: ‚Was steht ihr hier herum, was treibt ihr?’
Wir antworteten: ‚Wir möchten in das Halkevi gehen, aber man erlaubt es uns
nicht.’
Daraufhin sagte er: ‚Lasst diese Männer in Ruhe! Das sind bekannte Männer.
Das ist doch Âşık Veysel!’
Dieser Mann schickte uns zum Direktor der Literaturabteilung. Dort begrüßte
man uns: ‚Ah! Kommen Sie nur herein, kommen Sie nur herein!’ Im Halkevi
befanden sich auch einige Abgeordnete. Der Direktor der Literaturabteilung
rief diese herbei: ‚Kommt, es sind Volkslieddichter hier! Kommt und horcht
zu!’
Necib Ali Bey, einer der ehemaligen Abgeordneten: ‚Holla, das sind aber arme
Männer. Die schauen wir uns mal an. Denen müssen wir auch Anzüge machen
lassen. Sie sollen doch am Sonntag im Halkevi ein Konzert geben!’
Tatsächlich kauften sie uns je einen Anzug. Und wir gaben an diesem Sonntag
im Halkevi Ankara ein Konzert. Nach dem Konzert steckten sie auch Geld in
unsere Taschen. So konnten wir mit diesem Geld von Ankara in unser Dorf
zurückkehren.
Sein erstes ‚türkü’ (türkisches Volkslied), das er auf Platte sang, war
ein Lied des bekannten Dichters Âşık Izzeti aus dem Gebiet Emlek:
"Ich bin Mecnun*, habe ich Leyla gesehen
Nur ein einziges Mal schaute sie und ging vorbei.
Weder sie sagte etwas, noch fragte ich
Sie verzog die Augenbrauen und ging vorbei
Ich stellte nicht mal ein paar Fragen
War ihr Gesicht wie der Mond oder wie die Sonne
Mir erschien es wie der Morgenstern
Das Licht blendete mich, als sie vorbeiging.
Ich hielt es nicht aus in diesem Feuer
Dieses Mysterium konnte ich nicht lösen
Ich sah die Morgendämmerung nicht
Wie eine Sternschnuppe so schnell war sie vorbei.
Ich weiß nicht welches Sternzeichen
Diesen unseren Schmerz mildert
Lies manche dieser schmachtenden Blicke
Der Liebesschmerz schlug ein in die Brust, sie ging vorbei.
Izzeti, wie geheimnisvoll ist es
Im Schlaf sah ich einen Traum
Die Locken, wie eine Schlinge haben sie mich gefangen
Der Liebesschmerz hängt um meinen Hals, sie ging vorbei."
* Mecnun ve Leyla (Liebesgeschichte von Mecnun und Leyla, alt. türkische
Volkserzählung)
Mit der Gründung der "Köy Enstitüler" (Dorfinstitute mit spez.
Bildungsaufgaben) wurde er wiederum mit Hilfe von Ahmet Kutsi Tecer Saz-
Lehrer in verschiedenen Dorfinstituten, und zwar der Reihe nach in Arifiye,
Hasanoğlan, Çifteler, Kastamonu, Yıldızeli und Akpınar. Auf diesen Schulen
findet er die Gelegenheit, mit vielen intellektuellen Künstlern, die der
türkischen Kultur ihren Stempel aufgedrückt haben, bekannt zu werden. Dabei
entwickelt sich sein Gedichtstil immer mehr.
Im Jahre 1965 wurde Âşık Veysel von der Großen Türkischen
Nationalversammlung insofern ausgezeichnet, als er mittels eines besonderen
Gesetzes ein monatliches Einkommen vom Staat in der Höhe von 500 Lira für
seine „Herausragenden Dienste an der türkischen Muttersprache und der
nationalen Vereinigung“ zugesprochen bekam.
Am 21. März 1973, gegen 3.30 Uhr morgens, schloss er in seinem Haus in dem
Dorf Sivrialan für immer seine Augen. Dieses Haus wurde ihm zu Ehren in ein
Museum umgewandelt.
Wenn man Âşık Veysels Leben kurz zusammenfassen will, so finden wir die
schönste Beschreibung dafür in den Sätzen von Erdoğan Alkan:
"Der Fluss Kızılırmak gleicht einem Fragezeichen. Er entspringt bei Zara und
nach Hafik und Şarkışla verlässt er die Erde Sivas. Im Lauf eines Bogens
bewässert er Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Ankara und Çorum, im Landkreis
Bafra bei Samsun fließt er ins Meer. Die Lebensgeschichte Âşık Veysels ist
wie der Fluss Kızılırmak; Ein Ende bei Bafra, das andere bei Zara. Ein Leben
voller Schmerzen, das bis nach Bafra reicht, genährt wird durch das reiche
Wasser des Berges Kızıldağ östlich von Zara, und dort zuneige geht."
Seine Kunst
Weltansicht
Die Weltansicht des dörflichen - ländlichen Lebens, in dem das Schicksal
bestimmend ist, blieb auch bei Âşık Veysel vorherrschend. Nicht zuletzt
blieb er unter dem Einfluss der Dorf- und Kleinstadtkultur, in der er lebte
und unter dem Nichtvorhandensein einer Bildungsmöglichkeit. Wenn man dies so
sagt, so sollte man auch seinen psychischen Zustand, in dem er sich
zeitlebens befand, berücksichtigen. Ohne Zweifel kommt man nicht umhin zu
sehen, wie ihn seine schweren Schicksalsschläge in der Kindheit und Jugend
beeinflussten, seine Lebensansicht veränderte und ihn in Enttäuschungen
stießen.
Natürlich wird auch die Weltanschauung eines Künstlers von seiner sozialen
Umgebung, in der er sich befindet, bestimmt; Konkreter gesagt, sie wird auch
durch die materiellen Lebensbedingungen bestimmt. Die soziale Umgebung, in
der Âşık Veysel lebte und die von der Dorf- und Kleinstadtkultur geprägt war,
wirtschaftlich auf die Landwirtschaft gestützt war, in der die
landwirtschaftliche Produktionsweise und nicht der Kapitalismus herrschte,
keine Industrialisierung ... Und wenn man bedenkt, das parallel zu dieser
ökonomischen Struktur die Einflussfaktoren wie Bildung - Ausbildung auf sehr
niedrigem Niveau waren, die wirtschaftliche Angeschlagenheit einer
Gesellschaft, die gerade aus einem Krieg hervorging, hinzufügend, die von
Pocken hingerichtete Menschengeographie beachtet, so ist die soziale
Umgebung, die Veysel geformt hat, sehr leicht zu verstehen. Bedenkt man
zusätzlich die Realität, in der diese gesellschaftliche - soziale Umgebung
weit von der schriftlichen Kultur entfernt war, sich ihr gesamtes
literarisches - künstlerisches Erbe aus der mündlichen Überlieferung nährte,
so ist es umso leichter den Künstlertyp unter diesen Bedingungen zu
verstehen. Fügen wir dieser sozialen Umgebung obendrein noch eine physische
Behinderung, wie der Verlust eines Organs wie das Auge, hinzu, so kann
Veysel noch leichter verstanden werden, seine Gedichte noch leichter
zugeordnet werden.
Die Blindheit seiner Augen hat ihn in seiner Ganzheit beeinflusst:
"Wärst du auch ein Vogel, so hättest du meinen Händen nicht entfliehen
können
wenn ich hätte sehen können, dich mit meinen Augen“
Mit diesen Worten kann man leicht verstehen, wie tief seine Sehnsucht war.
Adnan Binyazar betont, dass dieses Fehlen der Sehkraft Veysels, in seiner
Interpretation der Halbverse das Salz im Honig war.
Tatsächlich suchte Âşık Veysel häufig den Schuldigen des Negativen im
Schicksal. Auf der anderen Seite nahm er aber auch positive Eigenschaften,
die das Leben bringt, wie zum Beispiel Schulen, Fabriken, Krankenhäuser in
seinen Gedichten auf. In dieser Hinsicht darf seine Anlehnung an das
Schicksal, der Fatalismus im Gegensatz zur Wissenschaft, nicht blindlings
als fixe Idee aufgefasst werden.
"Die Welt hat sich verändert so wie die Situation
Manche fahren zum Mond, manche ins Paradies"
In diesem Vers sieht man, dass er nicht nur vor wissenschaftlichen
Entwicklungen seine Ohren verschlossen hat, sondern Vergleiche anstellte und
eine ernsthafte Perspektive entwickelte. Von diesem Gesichtspunkt aus
betrachtet, verwendet er die Begriffe "ay" (Mond) und "cennet" (Paradies)
gleichzeitig für zwei unterschiedliche Glaubensauffassungen.
In einem anderen Gedicht:
Den reichsten Verstand der Welt sah ich
Ich fragte nach seinem Verstand, sagte die Schule.
Den Menschen Dienste und Hilfestellungen leisten,
Barmherzigkeitsgefühl, sagte die Schule.
Die schönste Kunst, die aus Wasser Feuer macht
Damit die Welt mit diesem Licht Schicht für Schicht bedeckt wird
Geschah diese Erschaffung mit Gedanken
Sie wurde mein Wegweiser, sagte die Schule.
Ist das eine Wundertat oder Begabung
Auch wenn das Auge nicht sieht, fasst die Seele wieder Mut
Auf einem verwaisten Feld dreht ein vom Weg Abgekommener wieder um
Er lässt einen Motor anbauen, ernten, sagte die Schule.
Er steckt Flügel an, damit du am Himmel fliegst
Er lässt dich das Meer mit Leichtigkeit überqueren
Wie erkennst du die Kälte, den Regen
Eine Wetterwarte wurde eingerichtet, sagte die Schule.
Verschiedene Transportmittel und noch die Züge
Arzt wird jener, der die Wunden versorgt
Hast du das gemacht oder die Heiligen
Du wirst staunen, was noch alles gemacht wird, sagte die Schule.
Das Radio hat mich in Verwunderung versetzt
Es kennt jede Sprache nicht jedoch Glas
Der wissenschaftliche Verstand hat dies geschaffen
Seine Lampen, seine Wellen, sagte die Schule.
Die Köpfe der Menschen sind es, die dies finden
Es ist die Wissenschaft, die die Wirklichkeit der Welt ist
Die das Fundament meiner ganzen Tätigkeiten darstellt,
Glaube mir Veysel, sagte die Schule.
Dieses Gedicht und andere ähnliche Beispiele zeigen, dass die
auβerweltlichen Begriffe Âşık Veysels wie Gott und Schicksal für ihn nicht
die einzige Lösung darstellen. In dieser Hinsicht kann man bei ihm keine
Starrheit erkennen. Er ist beweglich, tolerant.
Auch wenn ihn manchmal das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und des Nichts
überkam, so umarmte er doch das Leben mit vollen Händen. Er versuchte
ständig das Leben zu verstehen und ihm einen Sinn zu geben. Außerdem ist der
Begriff des Jenseits bei ihm nicht stark ausgeprägt.
Auf die Frage, ob Âşık Veysel eine bestimmte Philosophie verfolgte,
antwortete Ruhi Su: „Wenn Sie mit dem Wort Philosophie meinen, ob Veysel
eine Lebensauffassung hatte, die er sich zu eigen gemacht und innerhalb der
Gesellschaft vertreten oder empfohlen hat, dann ja, diese hatte er. Wie alle
gutmütigen, wohlwollenden Menschen, so empfahl er eine Beschäftigung. Je
nach dem wo er sprach, so kam es auch vor, dass er riet, den Traditionen
verbunden zu bleiben. Sein Glaube war ein Glaube, der sich auf Liebe,
Toleranz und die Kraft der menschlichen Schöpfungskraft stützte. Aber wenn
er gefragt wurde, was er über die gesellschaftliche Entwicklung denke, so
war er auch so klug zu spüren, was man hören wollte.“
Eine Besonderheit Veysels war auch folgende: Das nicht aushalten des Druckes
des religiösen Formalismus, der Versuch diesen zu durchbrechen, der Versuch
mit Gott eng vertraut zu sein. Richtiger noch, seine Verbundenheit mit der
Bektaşi- Tradition...
Wie in seinem Gedicht an Gott:
"Das Universum hast du geschaffen
Alles hast du aus dem Nichts ins Dasein gerufen
Nackt hast du mich hinaus geworfen
Deine Freigebigkeit, wo ist sie."
Nejat Birdoğan interpretiert:
„In manchen Gedichten finden wir Veysels Gedanken voller Enthusiasmus, als
Volksdichter jedoch noch unzureichend. Eigentlich sehen wir in diesen
Gedichten im Vergleich zu dem späteren Veysel ihn mehr als Erzieher der
Gesellschaft und weniger als Volkslieddichter. In diesen Werken sieht Veysel
das Gedicht als Mittel zur Unterstützung des Schutzes der Republik und als
Hilfestellung zur nationalen Einheit. In seinem Verhalten zeigt sich dies
auch. Was seine Gedanken betrifft, so kann man einen sauberen, redlichen
Mann beobachten, der sehr fleißig ist und besonderen Bedacht darauf legt,
sich richtigen Feststellungen, Beobachtungen zu zuwenden. Das er die Kaplan
Deresi Brücke, die über den Kızılırmak führt, dadurch errichtet hat, indem
er von Dorf zu Dorf wanderte und Geld sammelte, ist ein Zeichen der
Übernahme dieser Verantwortung und seines Charakters.
Unserer Meinung nach, so sind die ausgereiften Gedichte Veysels jene, die
die Menschlichkeit und den Menschen als solchen zum Thema haben. In diesen
Versen erzählt Veysel vom Ursprung des Menschen, von seiner Verkörperung,
von der Notwendigkeit, wie der Mensch in dieser Periode der Verkörperung
arbeiten muss, wie er sich verhalten muss und wie er am Ende des Weges
wieder zum Ursprung zurückkehrt. Mit einer anderen Definition, in diesen
Versen gab es den Mystik-Dichter Veysel. Seinen Glauben, dem er sich
verbunden fühlte, den er sich in diesem einsamen anatolischen Dorf aneignete,
hat Veysel durch intuitive Erkenntnis entwickelt. Veysel hat das große
Geheimnis des Alewitentums mit seinem Herzen verstanden.“
Veysel, der dem Aberglauben und unzeitgemäßem Verhalten gegenüber negativ
eingestellt war, war diesem Thema gegenüber ziemlich einfühlsam.
"Die Periode ist die Republik, das Jahrhundert 20
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
Die Welt ist im Aufbruch, sie geht zum Mond
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
Lass die gelben Ochsen, lass es sein, lass es sich entwickeln
Errichte keine Mauer vor den Augen, jeder soll aufwachen
An jeder Ecke soll eine Fabrik gebaut werden
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
Halte keinen Reisenden zurück
Achte die Ameisen und Bienen*
Wenn du so weitermachst erreichst du nicht Huri (Jungfrau im Paradies)
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
(*isl. Mystik: wenn du Ameisen - also irgendwelche Kreaturen - verletzt, so
kannst du das Paradies nicht erreichen)
Es wird dir kein Schaden zugefügt, flüchte nicht vor der Saz
Die Angst der Sünde kommt nicht von uns (Anm.: den Volkslieddichtern)
Ich sage nicht, dass du den namaz (Gebetsübung) aufgeben sollst
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
Unterstütze die Armen, unterrichte die Waisenkinder
Sind diese Wohltaten in unserem Glauben schlecht
Nimm das Wasserstoffatom wahr
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
Die Wassermengen des Regens
Gemessen, festgelegt, sind es Meter oder Quadrat
Schläfst du viel, lässt du meine Wunde größer werden
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
In den Himmel fliegen so viele Raketen
Sind all das nicht Lehren für uns
Man will die Geheimnisse des Mondes lösen
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
Die Existenz Gottes ist vorhanden im Menschen
Die Wissenschaft liegt im Gedanken, das Vermögen bei dir
Lass das Schiff fahren, sitze am Steuer
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
Du hast keine Ahnung, pflanz einige Pappeln
Jemanden der ohne Aufgabe herumläuft, nennt man Vagabund
Schließ nicht deine Augen, schau in die Welt
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann.
Veysel, was bleibst du stehen, ein jeder geht
Die Zeit bleibt nicht stehen, die Zeit sagt, pass dich an
Die Wissenschaft bringt viele Wunder hervor
Wach auf aus deiner Schläfrigkeit, schlaf nicht Landsmann."
"Sogar dieses Gedicht alleine erleuchtet das, was ich oben über ihn
herausgestrichen habe. Wie man sieht, kritisiert er die Werturteile der
Gesellschaft durch das Geben von Beispielen aus der konkreten Realität des
Lebens. Hier ergreift er Partei. Er stellt sich auf die Seite der
Wissenschaft, des Intellektualismus, des Fortschrittes, der konkreten
Wirklichkeit. Mit dem Ausdruck ‚Lass die gelben Ochsen, lass es sein, lass
es sich entwickeln’ nimmt er den Aberglauben ‚Die Welt ist auf den Hörnern
gelber Ochsen errichtet’ aufs Korn. Er sagt, dass man keine Mauer vor den
Augen errichten soll. Dann vermenschlicht er Gott, indem er sagt, dass die
Existenz Gottes im Menschen selbst vorhanden ist.
Allerdings, schauen wir uns seine Grundeinstellung an, so erkennen wir, dass
sich Veysel diesem Thema nicht als bewusster Gesellschafts-Volkslieddichter,
nicht mit einem gesellschaftlichen Bewusstsein genähert hat. Veysel schreibt
diese sich anscheinend von selbst entwickelnden Unterschiede Gott zu, dem
Schicksal und anderen natürlichen Kräften. Er hat sich nicht die
gesellschaftliche Ordnung gegenübergestellt, sondern die natürliche Ordnung."
Mit Betonungen wie „Seine Kunst ist eine romantische Kunst, die lobt und
sich auf Existierendes beschränkt“ wird Veysel in einen engen Rahmen
gesteckt. Mit diesen voreingenommenen Urteilen wird weder ein Beitrag zum
Verständnis Âşık Veysels geleistet, noch stellen sich die Forscher, die
diese Behauptungen aufstellen und auf die Tradition und die Weiterführung
der Tradition bauen als kompetent dar. Indessen existiert jedoch Âşık Veysel
mit seinem Leben, mit seinen Werken, mit seinen Gedichten. Nur wenn wir
unsere Interpretationen von dieser konkreten Tatsache ausgehend machen, so
können wir einen nützlichen Beitrag zum Verständnis leisten.
Wie ich in den obigen Feststellungen bereits angedeutet habe, war Âşık
Veysel ein Mensch, der hinsichtlich seines kulturellen Kreises, in dem er
sich befunden hat, von der Kultur des Dorf- und Kleinstadtlebens geprägt,
der von den Werten dieser Umgebung und dieser sozialen Ordnung geprägt wurde.
Eine typische Besonderheit, die diese Dorfkultur mit sich bringt, ist die
Inkonsequenz. Wenn wir es mit einem Ausdruck dieser Kultur sagen möchten, so
ist "Unbeständigkeit" auch bei ihm zu sehen. Solange die Halkevleri, die Köy
Enstitüleri existierten, die einen wesentlichen Beitrag zu seiner
Bekanntmachung, seiner Entwicklung geleistet haben, hat Veysel an ihrer
Seite gestanden, sie gelobt und gepriesen. Doch als es zur Schließung dieser
Einrichtungen kam, war er wenig betroffen und zeigte keine Reaktion. Das war
auch seine größte Schwäche.
Âşık Veysel und Tradition
Wie in allen Völkern so haben auch die ältesten türkischen künstlerischen
Werke ihre Wurzeln in mythischen Zeremonien.
Das bezüglich der türkischen Literaturgeschichte keine hervorragenden
Quellen vorhanden sind, hat damit zu tun, dass diese sich auf einem weiten
Feld ausgedehnt hat und immer in Bewegung stand, aber auch damit, dass die
schriftliche Niederlegung dieser Werke sehr spät begann. Dies wird auch
dadurch deutlich, dass man die ältesten Angaben zur türkischen Literatur und
Geschichte in chinesischen Schriftstücken finden kann. „Die ältesten
türkischen Dichter, wie Şaman von den Tongusen, Bo oder Bugue von den
Mongolen und Boryatlaren, Oyun (Ouioun) von den Jakuten, Kam von den Altay
Türken, Tadibei von den Samoiten, Tietoejoe von den Finovaren, Bksı- Bakşı
von den Kirgisen oder Ozan von den Oghusen sind Zauber-Dichter. Diese
Personen, die aus Berufen der Zauberei, dem Tänzer- und Musiker und dem
Heilwesen kamen, nahmen im Volk einen wichtigen Platz und Bedeutung ein. Zu
verschiedenen Zeiten und Plätzen veränderte sich natürlich der Grad ihrer
Bedeutung und ihres Einflusses, ihrer Kleider, ihrer verwendeten
Musikinstrumente, ihrer hervorgebrachten Werke. Aber verschiedenste
Eigenschaften und Aufgaben, wie die Darbringung von Opfern für die Götter im
Himmel, Begrabung der Seele der Verstorbenen, Treffen von Vorkehrungen und
Verhinderung von Schlechtem, Krankheit und Tod, die von bösen Geistern
hervorgerufen werden, Sendung mancher verstorbener Seelen in den Himmel und
Aufrechterhaltung von Erinnerungen wurden nur diesen Personen zugeschrieben.
Für alle diese auβergewöhnlichen Tätigkeiten wurden natürlich besondere
Zeremonien veranstaltet. Davon ist ein Teil in Vergessenheit geraten,
einiges ist abgeändert worden, aber manche dieser Zeremonien werden nach wie
vor bei den Kirgisen, Altay Türken und den Kasaken aufrechterhalten. Der
Schamane bringt sich bei diesen Zeremonien in einen ekstatischen Zustand,
trägt einige Gedichte vor und begleitet diese mit seinen eigenen
Musikinstrumenten. Diese Worte, die einen geheimnisvollen, mysteriösen
Charakter besitzen, gemeinsam mit ihrer musikalischen Vertonung, stellen die
älteste Version des türkischen Gedichtes dar.“
Ist eines der verwendeten Musikinstrumente auf diesen Zeremonien die "davul"
(große Trommel), so ist ein anderes zweifelsohne die "kopuz" (birnenförmige,
ein- oder mehr Saiten Gitarre). Abdülkadir Inan sagt: „Die heutigen
kirgisisch- kasachischen Schamanen verwenden nach wie vor die kopuz. Nach
der Annahme des islamischen Glaubens wurde bei den Oghusen die kopuz von den
Volkslieddichtern, die die Schamanen-Traditionen aufrechterhielten, als
gesegnetes Instrument bezeichnet. Dede Korkut tritt bei allen seinen
Veranstaltungen mit der kopuz auf und bei der Darbringung, Namensvergabe und
Applaus stimmt er jedes Mal die kopuz an. Der oghusische Held sammelt durch
den Laut der kopuz Kraft und siegt dadurch bei den Aufeinandertreffen.“
Es gibt mehr als genug Quellen, die darauf hinweisen, dass die türkischen
Volkslieddichter bei diesen Zeremonien dieses Musikinstrument verwendeten.
In den Dede Korkut- Erzählungen, von denen man annimmt, das sie im XIV. – XV.
Jahrhundert niedergeschrieben wurden, kann die Existenz der heiligen Haltung
gegenüber der kopuz gesehen werden. In der Erzählung "Uşun Koca Oĝlu Segrek
Boyu" wird dies wie folgt ausgedrückt: "Hey, ich habe nicht im Namen Dede
Korkuts die kopuz gespielt. Hätte er keine kopuz in Händen gehalten, hätte
ich dich für den Kopf meines Ağas in zwei Teile geteilt! Und er riss ihm die
kopuz aus den Händen."
Wie man bei allen primitiven Gesellschaften sehen kann, haben auch in der
türkischen Gesellschaft die Volkslieddichter oder Schamanen, an die man sich
auch mit dem Namen "baksi" erinnert, verschiedenste Aufgaben, wie das
Vortragen von Liedern, Spielen der Saz, kopuz oder davul, Zauberei,
Heilberufe und ähnliche verschiedene Tätigkeiten, auf sich genommen. In
dieser Hinsicht besaßen sie auf die Gesellschaft einen wichtigen Einfluss.
Die Verbreitung der Arbeitsteilung hat auch für die Personen und Charaktere,
die wie die Volkslieddichter, Schamanen verschiedenste Tätigkeiten
gleichzeitig durchführten, Veränderungen mit sich gebracht. Für religiöse
Zeremonien gab es nun religiöse Gelehrte, für das Heilwesen Doktoren,
verschiedenste Berufe entwickelten sich.
Prof. Dr. Umay Günay meint "Dass die durch die Annahme des islamischen
Glaubens verschwunden geglaubte Tradition des Volkslieddichters und
Schamanen fünf Jahrhunderte später plötzlich in einer islamisierten Form
wieder auftaucht, ist unserer Meinung nach nicht möglich.“, erklärt dies
folgenderweise: „Dass die Beispiele dieser Literatur aus den vergangenen
Perioden noch nicht festgestellt werden konnten, ist Pech. Nach der Annahme
des islamischen Glaubens waren die Türken mit dem Kampf und den Bemühungen,
einen neuen Staat zu schaffen, beschäftigt. Es ist nur verständlich, dass
mit den Anstrengungen, diese neue Religion zu verinnerlichen und
auszubreiten, das Schaffen von Werken, die heute unter dem Begriff Tekke-
Literatur bekannt sind, und dieser Kunst einen höheren Wert beizumessen, in
den Hintergrund geraten ist. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die
ersten Werke diesbezüglich nicht mit der Reim- und Versform von der arabisch-persischen
Literatur und jener der nachfolgenden Jahrhunderte, sondern mit unserer
nationalen Versdichtung und nationalen Elementen zurm Vorschein kamen. Dabei
ging die Tradition des Volkslieddichters und Schamanen einerseits teilweise
in die Tekke- Literatur ein, andererseits versuchte sie sich selbst
aufzulösen. Es wurde eine Flexibilität entwickelt, die immer ihre eigenen
Regeln und Formen berücksichtigte und sich dabei jedoch neuen Bedingungen
anpassen konnte. In den Dede Korkut Erzählungen, die im XV. Jahrhundert
niedergeschrieben wurden und dem XI. - XII. Jahrhundert zugeschrieben werden,
ist der Typus des Volkslieddichters, die Tradition des Gedichtvortragens das
Vortragen der Verse, mit denen die Helden der Erzählungen mit Begleitung der
Saz ihre Ereignisse und Gefühle ausdrückten, nicht unterschiedlich zur Âşık-
Dichtung, die vom XVI. Jahrhundert bis heute verfolgt werden kann. Die
charakteristischen Merkmale der Volkslieddichter-Schamanen-Tradition, wie
Zauberei, Heilwesen, Religionsgelehrte etc. verschwanden nach der Übernahme
des Islams. Die Âşık (Volkslieddichter) nahmen nun die Aufgabe der Erziehung
und der Vertretung der Kunst auf sich."
Der als Âşık bezeichnete Künstlertypus kann als Erschaffer von Gedichten,
einer Mischung aus Versen und Reimen bestehenden Erzählung, definiert werden.
Boratav sagt: "...Er ist ein Künstler, der einerseits die alte Tradition der
erzählenden Volksdichtung fortführt, aber andererseits, wie es auch der Name
ausdrückt, Liebes- und melancholische Gedichte (eine Art der Lyrik) vorträgt.
Seine Kreativität liegt in der improvisatorischen Wiedergabe: Er schreibt
keine Gedichte, er singt sie. Bei ihm kann das Gedicht nicht von der Musik
getrennt werden. Das heißt also, dass er nicht nur singt, sondern
gleichzeitig spielt und singt. Die Volkslieddichter unterscheiden das Singen
mit normaler Sprache und das Singen von Gedichten mit den Redensarten 'mit
der Sprache singen' und 'mit den Saiten singen'. Damit möchte man ausdrücken,
dass die begleitende Musik des Musikinstrumentes, der Saz, für den Âşık ein
nicht wegdenkbares Element beim Vortragen seiner Gedichte ist." Boratav fügt
hinzu: "Das heißt also, dass das Volksliedgedicht eine Kunstrichtung ist,
die aus der gesprochenen Sprache entstanden und sich entwickelt hat. Es ist
von der Musik nicht wegzudenken und beinhaltet Elemente wie
Schauspieldramatik einer gemischten Erzählkunst."
Wenn man sich Âşık Veysel in dieser Tradition vorstellt, sieht man, dass
wichtige Grundelemente der Âşık- Literatur wie das "bade içme" (Weintrinken)
beim ihm nicht vorkommen, ebenso die Meister-Lehrling Beziehung; wie man
auch in seiner Lebensgeschichte deutlich gesehen hat, ist Âşık Veysel durch
eine Art Wegweisung zum Vorschein gekommen, war er nicht vollkommen und doch
bis auf das Innerste mit dieser Tradition verbunden. Die Meister-Lehrling
Beziehung bedeutet, dass man von einem Meister sowohl die Saz wie auch die
Tradition lernt und eine gewisse zeitlang gemeinsam des Weges geht. Âşık
Veysels Situation entsprach dem nicht. Zum Beispiel hat Âşık Veysel keine
bade getrunken. Er war ein Âşık ohne bade. Auch findet man bei Âşık Veysel
nicht das typische Element der Âşık- Dichtung, das Geschichten erzählen.
Auch trifft man bei ihm nicht auf das traditionelle Aufeinandertreffen von
Âşık- Dichtern, das in dieser Kunst so üblich war, also dem "atışma" (Wettbewerb),
"muamma asma" (Rätsel aufgeben) oder "muamma çözme" (Rätsel lösen). Man
findet bei ihm zwar manche atışma, doch sind diese nicht von der Art und
Weise, wie sie in dieser Tradition üblich sind.
Natürlich nimmt Âşık Veysel in der türkischen Volkslieddichtung einen
wichtigen Platz ein. Seine Verbundenheit mit dieser Tradition bringt er auch
dadurch zur Sprache, dass er in einigen seiner Werke wichtige
Volkslieddichter erwähnt: Karacaoğlan, Dertli, Ich stamme von Yunus ab, Ich
habe manch ähnliche Eigenschaften wie Mansur. Aber dieses zur Sprache
bringen ist nicht mit der üblichen traditionellen Art dieser Kunst zu
vergleichen. In einem Gedicht singt er:
"Aus meiner vollen Hand habe ich getrunken
In verschiedenes Unglück bin ich gestürzt."
Diese Zeilen lassen zwar eine Verbindung zur Tradition des bade Trinkens
erahnen, in Wirklichkeit haben diese Zeilen aber nichts damit zu tun. Die
Betonung von Adnan Binyazar, der meinte, dass Veysel auch aus voller Hand
getrunken habe und somit das Recht habe, sich zu den Âşık- Dichtern zu
zählen, ist in dieser Hinsicht wohl etwas übertrieben.
In der Arbeit von Kurt Reinhard mit der Überschrift „Typen der Âşık Melodie
in der Provinz Sivas“ wird die als Âşık Veysel Richtung und die Âşık- Weisen
Zentralanatoliens von den anonymen Volksliedern und –weisen folgenderweise
unterschieden: „Die Âşık- Weisen stehen mit der Zahl der Halbverse in
Verbindung. Wiederholte Wörter werden in einer offenen Form ausgesprochen.
In den Weisen werden bestimmte Motive häufig wiederholt, bei dem Volkslied
wird die Saz bei bestimmten Abschnitten eingesetzt. Das plötzliche Ende des
Volksliedes oder deren langsamer werden gegen Ende des Stückes, hängt von
der Stimmung des Saz- Spielers und dessen Können ab. Bei den Weisen der
Âşık- Dichtung gibt es Beispiele, die sowohl die Linksstimme als Hauptton
oder die ‚la’ und ‚mi’ Stimmen als Hauptton verwenden.
Die Âşık- Weisen teilen sich in zwei Gruppen ein, die Gruppe, bei der die
Sprache im Verhältnis zur Musikweise im Vordergrund steht und die andere
Gruppe, bei der die Melodie eine wichtigere Rolle einnimmt. Mit dem Fuß wird
ein Rhythmus vorgegeben, dem sich der Sprach- Rhythmus anpasst. Bei der
Gruppe, bei der das Wort im Vordergrund steht, wird die Musik verlangsamt
und dem Fuß- Rhythmus angepasst. Die Musikweise bleibt somit häufig hinter
den Worten zurück, manchmal wird auch die Musik ausgelassen, um die Worte
besser verstehen zu können. In der anderen Gruppe, in der die Musik im
Vordergrund steht, wird eine Silbe oft über mehrere Noten hinweg gesungen,
wodurch der Text schwieriger zu verstehen ist."
Man erhält also, alles dies beachtend, folgendes Bild: 1. Âşık Veysel ist
nach klassischer Auffassung kein Âşık- Dichter, 2. die Tradition ist mit
Âşık Veysel gebrochen.
Ahmet Kutsi Tecer macht diesbezüglich einen interessanten Vergleich und eine
interessante Interpretation: „Während bei Âşık Veysel, Veysel Şatıroğlu
wieder zum Leben erwacht, wird bei Veysel Şatıroğlu Âşık Veysel beendet.
Sein Unterschied zu denen, die aus der Periode des Tanzimat kamen, ist seine
Stimme. Seine Saite wurde für uns gebunden. Die Saite des Tanzimat war eine
imitierte. In einer Hinsicht war Veysel wie die anderen Zeitgenossen. Zum
Beispiel, so häufig Ceyhun Kansu Veysel vorgetragen hat, so häufig hat auch
Şatıroğlu Ceyhun vorgetragen. In dieser Hinsicht haben sich Veysel und seine
Zeitgenossen gegenseitig angezogen. Wie unterschiedlich Ceyhun Kansu und
Faruk Nafız Çamlıbel in ihrer Art und Weise sind, so unterschiedlich sind
auch Şatıroğlu und seine Zeitgenossen. Der Unterschied, der Veysel von den
anderen trennt, ist, dass er nicht wie sie aus der Tradition des Tanzimat
kommt, sondern aus der Tradition des Volksgedichtes. Veysel Şatıroğlu hat
als Âşık Veysel die Tradition des Volksgedichtes gelebt und ist in die
heutige Zeit von dort gekommen.
Meiner Meinung nach ist die größte Besonderheit Âşık Veysels in seinem Bruch
mit der Tradition zu sehen. Die Schwäche und schwere Didaktik seiner ersten
Werke ist auch in diesem Faktum zu sehen."
Allerdings darf man nicht vergessen, dass man ihn nicht gänzlich von der
Tradition abstrahieren kann. So wie Enver Gökçe sagte:
"Die gemeinsamen Besonderheiten der Volksdichtung, wie die Untrennbarkeit
von Worten und Saz, die idealistische Neigung und dessen Abstrahierung in
den Volksgedichten, sind auch hauptsächliche Elemente der Kunst Âşık Veysels.
Kurz gesagt ist Âşık Veysel, mit seinem natürlichen Einfühlungsvermögen,
obwohl dieses nicht an eine bestimmt religiöse Klasse gebunden ist, mit
seinen mystischen Seiten, seinem Verständnis vom Weltall, der Existenz, der
Schöpfung, ein mit der Tradition verbundener Saz- Dichter."
Âşık Veysel ist somit traditionell, wie auch modern. Wenn wir später genauer
auf seine Werke eingehen, so können wir dies detaillierter sehen. Allerdings
kommt dies nicht von selbst, sondern ein Bewusstsein bringt ihn dorthin. Zum
Beispiel, obwohl er in einer alewitischen Kultur aufgezogen wurde und sein
Vater der "Tekke"- Tradition verbunden war, singt Âşık Veysel keinen "duvaz
imam" wie alle anderen Volkslieddichter. In keinem einzigen Gedicht kommen
die Wörter "Schah" oder "12 Imam" vor. Obwohl Âşık Veysel aus der
alewitischen Kultur hervorgebracht wurde und seine besuchten Dörfer zum
Großteil alewitische Dörfer waren. Sein Zeitgenosse Ali Izzet Ukan war
indessen nicht so. Er war dabei so entschlossen, dass er das Werk Pir
Sultans mit den Zeilen "Lass uns zum Schah gehen" abänderte. Das heißt, dass
Âşık Veysel von seiner Umgebung in dieser Hinsicht von Anfang an geprägt war,
oder dass er diese Haltung als Lebensphilosophie aufgenommen hat. Wie auch
immer, Veysel war in dieser Hinsicht sehr konsequent. Und es gibt noch einen
Punkt: Er distanzierte sich davon, ein Dorf- oder Landdichter zu sein.
Veysel bricht aus dem Dorf nach außen. Es gibt noch eine soziale Umgebung,
die sein Leben, seine Werke prägen: die Kleinstadt.
EINEM SORGENLOSEN MENSCHEN KANN ICH MEIN LEID NICHT ERZÄHLEN
Âşık VEYSEL



